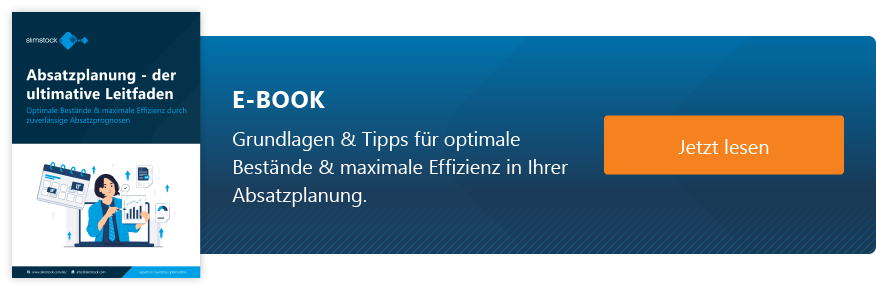Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis- Der iberische Blackout und seine Folgen auf die Lieferketten
- Wirtschaftliche Folgen des Stromausfalls
- Wie wirkte sich der Blackout auf die Lieferkette aus?
- Störungen der Lieferkette sind das neue Normal
- Fazit: Die Stärkung der Resilienz von Menschen und Lieferketten ist unerlässlich
Überblick
Ein zehnstündiger Stromausfall auf der Iberischen Halbinsel im April stoppte die wirtschaftliche Aktivität abrupt und störte die Supply Chain massiv, indem er den Handel lahmlegte, die Distributionslogistik stoppte (WMS-Ausfall) und die Produktion zum Erliegen brachte; das unterstreicht den kritischen Bedarf an robuster Supply-Chain-Resilienz gegenüber zunehmend häufigen, unvorhersehbaren Störungen.
Die Auswirkungen dieses historischen Blackouts variierten stark je nach individueller Situation. Menschen, die im Homeoffice arbeiteten, erlebten die Situation anders als jene, die stundenlang in Zügen oder Aufzügen festsaßen. Da die akute Phase der Krise weniger als zwölf Stunden dauerte, trug jedoch dazu bei, dass die Folgen für die Allgemeinbevölkerung insgesamt begrenzt blieben.
Wirtschaftliche Folgen des Stromausfalls
Der massive Stromausfall brachte die Wirtschaftstätigkeit in Spanien und Portugal am 28. April für weite Teile des Tages abrupt zum Erliegen. Geschäfte blieben geschlossen, Fabriken standen still und Büros wurden evakuiert.
Die direkten Auswirkungen auf das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sind zwar erheblich, dürften jedoch ein einmaliges Ereignis bleiben. In Spanien schätzte der Arbeitgeberverband CEOE die wirtschaftlichen Verluste allein am ersten Tag auf rund 0,1 % des BIP – das entspricht etwa 1,6 Milliarden Euro.
Das Ministerium für Wirtschaft, Handel und Unternehmen meldete darüber hinaus, dass der Blackout zu einem Rückgang der Zahlungsvorgänge um 55 % führte, insbesondere bei Kredit- und Debitkartenzahlungen. Grund dafür war, dass viele Kartenlesegeräte ausfielen und zahlreiche Geschäfte geschlossen blieben.
Das Ministerium stellte außerdem fest, dass ein Teil der entgangenen Umsätze – schätzungsweise zwischen 130 und 140 Millionen Euro – in den Stunden und Tagen nach Wiederherstellung der Stromversorgung nachgeholt wurde. Dennoch fordern mittlerweile zahlreiche Wirtschaftsverbände Entschädigungen für die entstandenen Verluste.
Wie wirkte sich der Blackout auf die Lieferkette aus?
Der zehnstündige Strom- und Internetausfall auf der Iberischen Halbinsel hatte unmittelbare Auswirkungen auf die Lieferketten. Der Ausfall von Telefon- und Internetverbindungen machte die Koordination von Lieferungen und der Versorgung zu einer äußerst schwierigen Aufgabe.
Wie genau aber wirkten sich der Blackout auf die einzelnen Glieder der Lieferkette aus?
Einzelhandel: Nachfrageeinbruch und unerwartete Spitzen
Einzelhändler wurden vom Stromausfall sehr unvorbereitet getroffen. Da die stationären Geschäfte ohne Strom waren, die Kassensysteme (POS-Terminals) nicht funktionierten und auch die E-Commerce-Plattformen offline gingen, kam die Nachfrage schlagartig zum Erliegen.
In Schlüsselsektoren wie Lebensmittel, Pharma und Nahversorgung zeigte sich jedoch ein Rebound-Effekt: Sobald die Stromversorgung wiederhergestellt war, führten ungewöhnlich hohe Kaufspitzen zu einer Verzerrung der Nachfrageprognosen. Einzelhändler, die ihren Betrieb weitgehend aufrechterhalten konnten, profitierten von der verlagerten Nachfrage – auf Kosten jener, die während des Ausfalls schließen mussten.
Zudem kam es zu Panikkäufen von lebenswichtigen Notfallartikeln wie Kerzen, Batterien und Flaschenwasser – die Regale waren binnen weniger Stunden leergefegt. Da es sich jedoch um eine nur kurzzeitige Störung handelte, ist kein nachhaltiger Schockeffekt zu erwarten.
Distributoren ohne Verbindung
In den Logistikzentren legte der Ausfall von Lagerverwaltungssystemen (LVS), Funkverbindungen und automatisierten Förderanlagen den Betrieb lahm. Teilweise mussten manuelle Notprozesse ohne Rückverfolgbarkeit improvisiert werden.
Die fehlende Transparenz über laufende Bestellungen und die Unmöglichkeit, sich mit Einzelhändlern oder Herstellern abzustimmen, führte zu Engpässen und Lieferverzögerungen, die sich über mehrere Tage hinweg auswirkten. Ohne funktionierende Datenverbindungen wurden viele Entscheidungen auf der Basis veralteter oder unvollständiger Informationen getroffen.
Erwähnenswert ist, dass große Logistikzentren oft über eigene Notstromaggregate verfügen, was half, die schlimmsten Folgen abzumildern.
Auch der Verkehr blieb vom Chaos nicht verschont: Der Zugverkehr kam vollständig zum Erliegen, und auch der Straßenverkehr war stark eingeschränkt – unter anderem durch Störungen bei der Treibstoffversorgung und den Ausfall zahlreicher Ampelanlagen.
Hersteller: Produktionslinien gestoppt
Hersteller, die nicht auf alternative Stromquellen zurückgreifen konnten, waren gezwungen, ihre Produktion zu stoppen und ihre Mitarbeitenden nach Hause zu schicken. Durch den Ausfall der Planungssysteme kam es sowohl zu Unterbrechungen in den Produktionslinien als auch zu einem Verlust der Übersicht über Rohstoff- und Komponentenbestände.
Einkauf und Beschaffung: Entscheidungen ohne Daten
Auf allen Ebenen – vom Einzelhandel bis zur Industrieproduktion – standen die Einkaufs- und Beschaffungsteams vor der gleichen Herausforderung: Sie mussten ohne zuverlässige Daten arbeiten. Der Zusammenbruch der Systeme für Planung und Lieferantenkommunikation verhinderte in vielen Fällen die Vergabe von Aufträgen, das Management von Störungen sowie die Durchführung alltäglicher Aufgaben innerhalb der Lieferkette.
Störungen der Lieferkette sind das neue Normal
Auf den ersten Blick scheint Spanien ein Land zu sein, das weniger anfällig für Störungen in der Lieferkette ist: gut ausgebaute Infrastruktur, stabiles Klima, geografisch weit entfernt von Krisenregionen. Dennoch wird das Land regelmäßig von Unterbrechungen in der Lieferkette betroffen, ausgelöst sowohl durch globale als auch durch lokale Ereignisse. Ein deutliches Zeichen dafür, dass Störungen in der Lieferkette inzwischen zur neuen Normalität gehören.
Instabilität auf zwei der weltweit wichtigsten Schifffahrtsrouten
In den vergangenen Monaten kam es auf zwei der wichtigsten Schifffahrtsrouten des internationalen Handels, dem Suezkanal und dem Panamakanal, zu gravierenden Störungen, die erhebliche Auswirkungen auf globale Lieferketten hatten.
Einerseits erlebt der Panamakanal eine historische Dürre: Der anhaltende Niederschlagsmangel hat den zulässigen Tiefgang sowie die Anzahl der täglichen Schiffspassagen drastisch reduziert. Dies führt zu Staus, erheblichen Verzögerungen und kostspieligen Umwegen für Schiffe, die Container und zentrale Rohstoffe nach Europa transportieren. Logistikunternehmen sehen sich gezwungen, ihre Routen neu zu planen und zusätzliche Kosten in Kauf zu nehmen – mit direkten Auswirkungen auf die Endpreise vieler Produkte.
Gleichzeitig ist der Suezkanal infolge von Angriffen der Huthi-Rebellen auf Handelsschiffe im Roten Meer zu einem geopolitischen Krisenherd geworden. Die Übergriffe, die sich zunächst gegen Schiffe mit Verbindungen zu westlichen oder israelischen Interessen richteten, haben zahlreiche Reedereien dazu veranlasst, diese Route zu meiden und stattdessen den Umweg über das Kap der Guten Hoffnung zu nehmen. Das verlängert die Transitzeit nach Europa um 10 bis 15 Tage, erhöht die Frachtkosten und reduziert die Planbarkeit von Lieferterminen.
Für europäische Unternehmen bedeutet diese Situation ein permanentes Umfeld der Unsicherheit. Sie sind gezwungen, ihre Lieferketten robuster aufzustellen: durch bessere Planung, eine breitere Diversifizierung ihrer Lieferanten und eine deutlich höhere Reaktionsfähigkeit auf globale Krisenereignisse.
Der Ukrainekrieg und seine Auswirkungen auf Europas Energieversorgung
Der Krieg in der Ukraine hat tiefgreifende und nachhaltige Auswirkungen auf die europäischen Lieferketten – nicht nur durch die direkte Unterbrechung des Handels mit Russland und der Ukraine, sondern auch durch weitreichende Folgen für strategische Branchen. Engpässe bei Rohstoffen wie Weizen, Mais, Düngemitteln, Aluminium und Erdgas setzen Schlüsselindustrien wie die Agrar- und Ernährungswirtschaft, die chemische Industrie sowie das verarbeitende Gewerbe zunehmend unter Druck.
Gleichzeitig haben die steigenden Energiepreise die Produktions- und Transportkosten in ganz Europa stark ansteigen lassen. Viele Unternehmen waren gezwungen, ihre Liefernetzwerke neu zu überdenken, alternative Bezugsquellen zu erschließen und ihre Lagerstrategien anzupassen, um in einem hochvolatilen Umfeld wettbewerbsfähig zu bleiben.
Spanien: Klimakrise und soziale Spannungen
In Spanien stellte eine Kombination aus Extremwetterereignissen und soziale Spannungen die Widerstandsfähigkeit der Lieferketten auf eine harte Probe. Der jüngste DANA (Unwetterzelle), der die Region Valencia heimsuchte, verursachte Überschwemmungen, legte Logistikzentren lahm, beschädigte Verkehrsinfrastrukturen und setzte Tausende von Geschäften und Lagerhäusern außer Betrieb. Diese lokale Krise hatte landesweite Auswirkungen: Die Warendistribution geriet ins Stocken, und insbesondere in den Sektoren Lebensmittel, Einzelhandel und Pharma kam es zu massiven Störungen in den Warenflüssen.
Hinzu kamen anhaltende Arbeitskämpfe. Transportstreiks, zu denen die Gewerkschaften UGT und CCOO im Jahr 2024 aufgerufen hatten, sowie sektorale Arbeitsniederlegungen in der Hafen- und Schienenlogistik führten zu wiederholten Unterbrechungen im Warenverkehr.
Am Mittag und Nachmittag des 28. April herrschten auf der Iberischen Halbinsel erneut pandemieähnliche Zustände. Ein großflächiger Stromausfall sowie der Ausfall der Internetverbindungen führten zu Szenen, die aus der Zeit gefallen schienen: Menschengruppen, die sich um batteriebetriebene Radios versammelten, um Informationen über das Geschehen zu erhalten – Bilder, die stark an einen Ausnahmezustand erinnerten.
Wie in den ersten Tagen der COVID-19-Pandemie trieb die Unsicherheit viele Menschen in Supermärkte und Lebensmittelgeschäfte. Während damals Toilettenpapier besonders begehrt war, standen diesmal Batterien, Radios und Kerzen im Mittelpunkt des Interesses.
Fazit: Die Stärkung der Resilienz von Menschen und Lieferketten ist unerlässlich
Der Stromausfall im April wirkte wie ein unfreiwilliger Stresstest. Er zeigte, dass europäische Lieferketten zwar grundsätzlich robust, aber keineswegs unverwundbar sind. Die rasche Wiederherstellung der Infrastruktur und der Lieferflüsse konnte die schlimmsten Auswirkungen zwar begrenzen. Dennoch wurde deutlich, wie wichtig vorausschauende Planung und belastbare Systeme sind. Resilienz wird damit zu einem strategischen Imperativ: Nur wer Unterbrechungen antizipieren, Auswirkungen minimieren und sich schnell erholen kann, bleibt langfristig widerstandsfähig und wettbewerbsfähig.
Eine besondere Ironie des Schicksals: Erst einen Monat vor dem Stromausfall hatte die EU-Kommissarin für Katastrophenschutz, Krisenmanagement und Gleichstellung, Hadja Lahbib, den Bürgerinnen und Bürgern der EU empfohlen, einen 72-Stunden-Notfallvorrat anzulegen – inklusive Wasser, Konserven, Lichtquellen und einem batteriebetriebenen Radio. In Spanien wurde dieser Vorschlag zunächst mit Spott bedacht. Heute ist der Witz nicht mehr ganz so lustig: Seit dem Stromausfall haben viele Haushalte begonnen, den Empfehlungen der EU tatsächlich zu folgen.